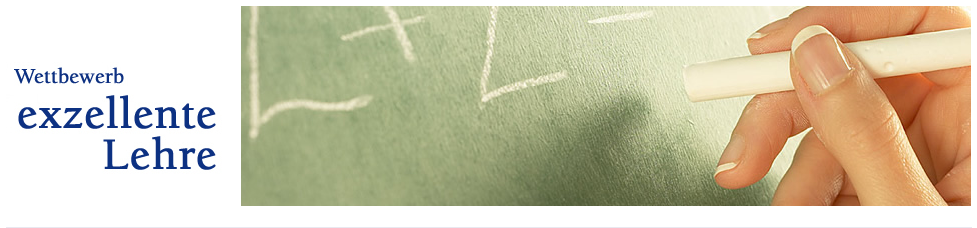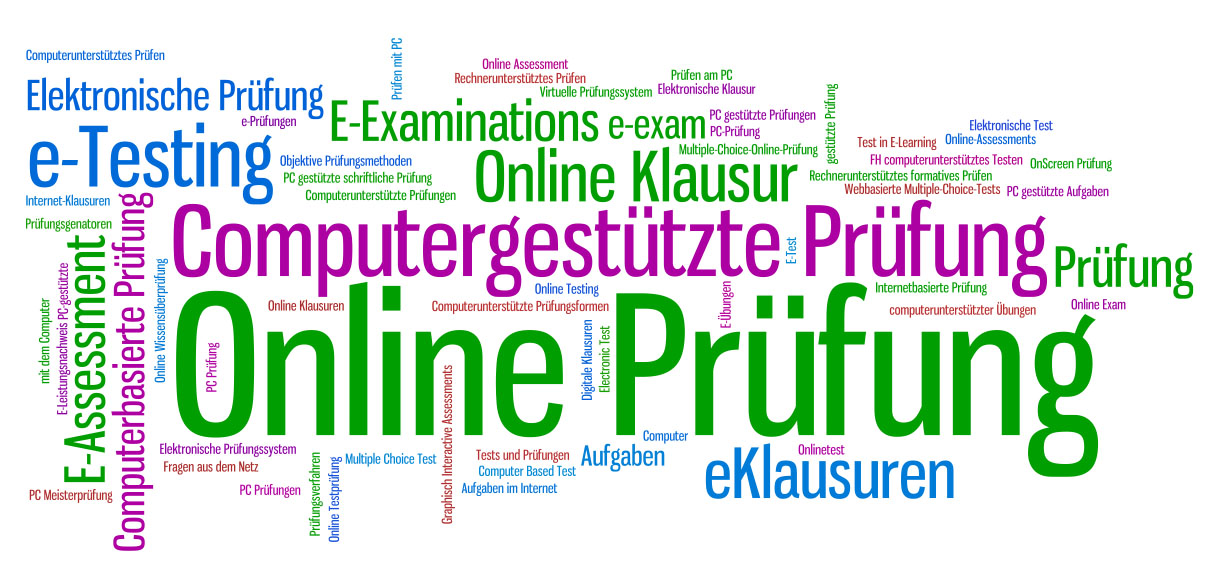Kreis, A., Lügstenmann, F. & Staub, F. (2008). Kollegiales Unterrichtscoaching als Ansatz zur Schulentwicklung. Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.
Um die Qualitätsentwicklung auf Schul- und Unterrichtsebene anzuregen, entwickelten einige Schulleitungen des Kantons Thurgau ein Konzept, in welchem auch gegenseitige Unterrichtsbesuche vorgeschlagen wurden. Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) initiierte parallel dazu die Interventionsstudie „Unterrichtsentwicklung durch fachspezifisches Coaching“ (Kreis, Staub, Brunner, Rüegg & Morger, 2005; Kreis & Staub, 2007), in welcher Praktikumslehrpersonen zu Unterrichtscoaches für das Fach Mathematik ausgebildet werden. Die Weiterbildung basiert auf einem Ansatz zur Gestaltung von Lernsituationen für Lehrpersonen, dem Fachspezifisch-Pädagogischen Coaching (Staub, 2001, 2004, 2006; West & Staub, 2003).
Dieses Fachspezifisch-Pädagogische Coaching wurde in einer angepassten Form als Instrument zur schulinternen Unterrichtsentwicklung erprobt. Dies unter dem Namen „Kollegiales Unterrichtscoaching“.
Den Lehrpersonen wurden Werkzeuge angeboten, die es ihnen erleichtern ihre eigentliche Kerntätigkeit “ das Unterrichten und Lehren “ mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit externen Expertinnen und Experten zu überdenken und auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler hin zu optimieren. Wie im Fachspezifisch-Pädagogischen Coaching ist auch für das kollegiale Unterrichtscoaching charakteristisch, dass Lehrpersonen Unterricht unter einer fachspezifischen Perspektive kooperativ und gemeinsam verantwortet planen, durchführen und reflektieren. Im Unterschied zum Fachspezifisch-Pädagogischen Coaching wird im kollegialen Unterrichtscoaching jedoch nicht vorausgesetzt, dass der Coach über ein reicheres fachspezifisches und fachdidaktisches Wissen verfügt als die gecoachte Lehrperson. Das Coaching findet unter gleichrangigen Kolleginnen und Kollegen statt, wobei die Beteiligten abwechslungsweise je die Rolle des Coachs oder der gecoachten Person einnehmen.
Im hier herunterladbaren Bericht werden zentrale Merkmale, Vorgehensweisen und Werkzeuge des kollegialen Unterrichtscoachings dargestellt und Ergebnisse einer Begleituntersuchung mit zwei Schulen berichtet.
Quelle:
Kreis, A., Lügstenmann, F. & Staub, F. (2008). Kollegiales Unterrichtscoaching als Ansatz zur Schulentwicklung. Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.